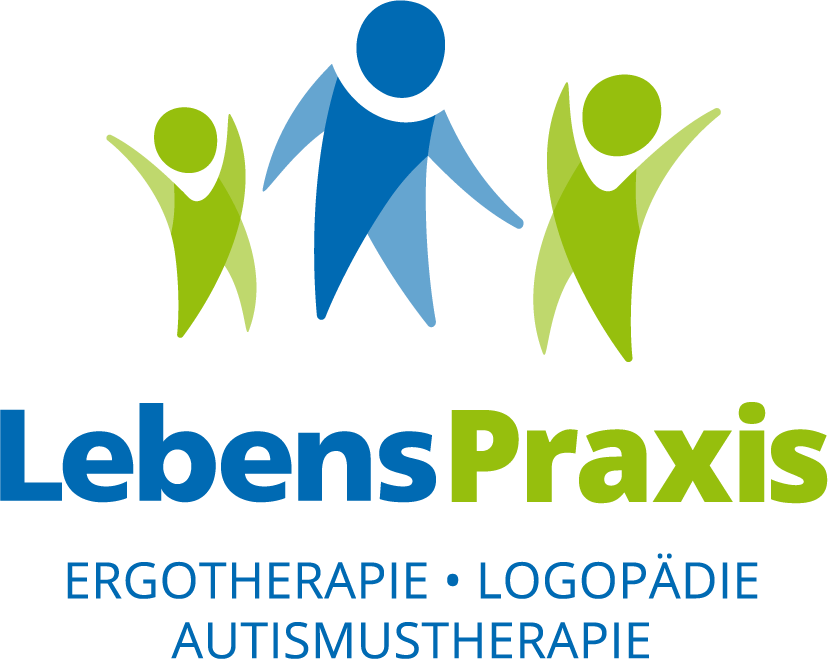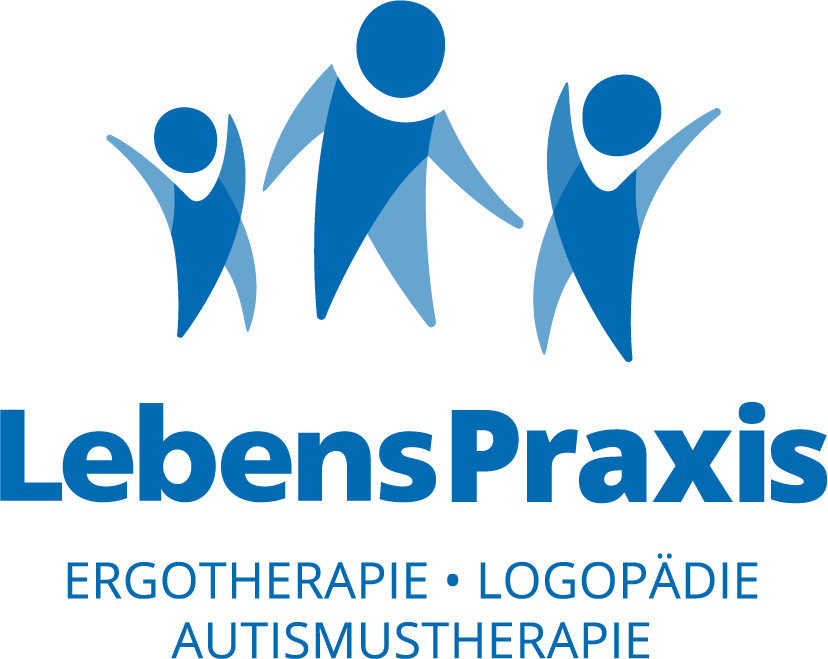In unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus dem Autismus-Spektrum ist es uns wichtig, individuell auf jeden einzugehen. Wir entwickeln auf unsere Klienten zugeschnittene Hilfen, die sie darin unterstützen ein Höchstmaß an Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu erlangen. Ihre Stärken und Interessen stehen im Mittelpunkt. Eine große Rolle spielt hierbei auch die Familie und das soziale Umfeld. Daher beziehen wir auch sie in die Therapie ein.
Die Therapie findet in der Regel in unseren Praxisräumen statt. Wenn es jedoch für den Therapieerfolg notwendig ist, können die Sitzungen gemeinsam mit allen Beteiligten bei Bedarf auch mal zu Hause bzw. im sozialen Umfeld stattfinden. Wir betrachten immer den Einzelfall und entscheiden dann, welcher Weg der beste ist.
Die eingesetzten Methoden orientieren sich am Alter unserer Klienten, an den Ergebnissen der Förderdiagnostik und den Anliegen der Sorgeberechtigten und des Leistungsträgers. Bei Bedarf erfolgt eine enge Zusammenarbeit mit dem Kindergarten bzw. der Schule und mit weiteren Einrichtungen ( z.B. Logopädie, Ergotherapie, sozialpädagogische Familienhilfe)
Wesentliche Schwerpunkte der therapeutischen Zusammenarbeit sind Strukturierung und Visualisierung.
In der Therapie werden alle wesentlichen Bereiche des Lebens der Kinder und Jugendlichen aus dem Spektrum erfasst:
- Kommunikation (verbale und nonverbale Anteile, alternative Kommunikationsmöglichkeiten)
- Soziale Interaktion (Kontaktaufbau, situationsadäquater Ausdruck von Gefühlen, Meinungen usw., Schärfung der sozialen Wahrnehmung)
- Erweiterung des Verhaltensrepertoires und der individuellen Flexibilität (Rituale, Verhaltensalternativen)
- Selbstregulation und Selbststeuerung (Arbeitsverhalten, Krisen)
- Sensomotorik (Sinne, Wahrnehmungsverarbeitung)
- Lebenspraktische Fähigkeiten und Selbstständigkeit (Körperhygiene, Handlungsplanung)
- Entwicklung der Identität und Ausbildung einer Persönlichkeit (Selbstbild, Reduzierung von Ängsten und Vermeidung)
- Soziale Integration
Folgende methodischen Ansätze fließen in die therapeutische Arbeit ein:
- An TEACCH angelehnte Methoden (kombiniert pädagogische und verhaltenstherapeutische Elemente und strukturiert das Lernen, indem Raum, Zeit, Abläufe und Materialien strukturiert werden)
- Elemente aus THOP (Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten)
- PECS (nonverbales Kommunikationssystem in Form von Bildkarten)
- Social Stories/ Comicstrip
- Marte Meo
- Methoden der systemischen Beratung
Die Therapie in der „LebensPraxis Autismus“ verläuft in folgenden Schritten:
Zunächst findet ein Kennenlerngespräch mit dem Kind/dem Jugendlichen aus dem Spektrum und seinen Eltern statt. Hier erfahren die Klienten wie die „LebensPraxis“ arbeitet und werden bei Bedarf bei der Beantragung einer Autismus-Therapie unterstützt.
Wenn die Therapie vom Leistungsträger (Sozialamt oder Jugendamt) bewilligt wurde, finden im Rahmen der Förderdiagnostik mehrere Termine mit dem Kind/dem Jugendlichen und Gespräche mit den Eltern statt, um den Förderbedarf zu ermitteln.
Der Förderbedarf wird in einer Stellungnahme an den Leistungsträger zurückgemeldet und in einem gemeinsamen Gespräch (Kind/Jugendlicher aus dem Spektrum, Eltern, Mitarbeiter*in des Leistungsträgers, Autismustherapeut*in) die Therapieziele und der Stundenumfang festgelegt.
Wenn der bürokratische Teil erledigt ist, startet die Therapie.